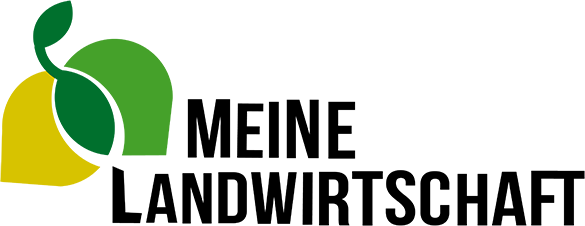Gutes Essen muss Schule machen
Das Schulessen kann ein zentraler Hebel für die Ernährungswende werden. Dafür müsste sich allerdings Grundlegendes ändern
Immer mehr Kinder und Jugendliche verbringen auch den Nachmittag in der Schule. Für sie muss es ein Mittagessenangebot geben, so haben es die Kultusminister*innen festgelegt. Weil heute bereits 3,4 Millionen Schüler*innen am Ganztagsbetrieb teilnehmen, geht es potenziell um ebenso viele Portionen am Tag – Tendenz steigend.
Das Schulessen prägt den Geschmack der jungen Generation. Es trägt auch zur Gerechtigkeit bei, wenn alle Kinder unabhängig vom Elternhaus einmal am Tag zusammensitzen und das Gleiche essen. Außerdem schlummert in der Schul- bzw. Gemeinschaftsverpflegung eine große Nachfragemacht, was Herkunft, Qualität und Zusammensetzung der Zutaten angeht. Im Schulessen liegt also ein starker Hebel für die Ernährungswende, sollte man meinen.
Auf die Plätze, fertig, satt
Doch die meisten Schulen haben keine eigenen Küchen. In Ostdeutschland wurden sie nach der Wende häufig herausgerissen, in den meisten Berliner Schulneubauten sind sie gar nicht erst eingeplant. Die Speiseräume wurden meist irgendwo reingequetscht und manchmal sogar in düsteren Kellerräumen untergebracht. In der Regel liefern Caterer das Essen. Einige bringen die fertigen Gerichte in Warmhalteboxen, anderswo werden die Mahlzeiten vor Ort aufgewärmt.
Weil es zu wenig Mensaplätze gibt, haben viele Kinder keine Zeit, sich in Ruhe hinzusetzen und das Essen gemeinsam zu genießen. Pädagog*innen sind vor allem damit beschäftigt, sie möglichst rasch durch den Prozess von der Tellerausgabe bis zum Tischabwischen zu schleusen, bevor die nächste Gruppe kommt. Der Geräuschpegel ist enorm, die Räume oft lieblos gestaltet. Die meisten Schulleitungen sehen das Mittagessen allein unter dem Versorgungsaspekt und nicht als integrativen Teil des Schullebens. Dass Lehrer*innen mit ihren Schüler*innen gemeinsam essen, ist nicht vorgesehen. Die Chance, dass die Kinder die Essensvorbereitung miterleben, gibt es nicht.
Unter diesen Voraussetzungen ist es kaum verwunderlich, dass mancherorts gerade einmal zehn Prozent der Schulkinder am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen. „Schmeckt nicht,“ ist eine häufige Begründung. Auch die Kosten, die vielerorts von den Eltern getragen werden müssen, führen zu einer mäßigen Nachfrage.
Schulessen ist politisch
Zuständig für bessere Rahmenbedingungen sind die Länder, die Umsetzung liegt bei den Kommunen. In vielen Amtsstuben fehlt es jedoch schlicht an Kompetenz, einen differenzierten Anforderungskatalog für die Schulverpflegung zu erstellen und die Einhaltung später zu kontrollieren. Weil es für die Schulträger am einfachsten ist und klare Vorgaben fehlen, bekommen oft die billigsten Caterer den Zuschlag. Häufig herrscht auch Angst, dass ein unterlegener Bewerber vor Gericht ziehen könnte. Da ist ein reiner Preiswettbewerb der einfachste Weg.
Berlin versucht seit einigen Jahren, neue Wege zu gehen. Seit Herbst 2019 haben alle 170.000 Grundschüler*innen von der 1. bis zur 6. Klasse Anspruch auf ein kostenloses Mittagessen. Auch gelten inzwischen ambitionierte Standards, was die Zutaten betrifft. Der Bioanteil muss mindestens 50 Prozent betragen, Reis und Bananen dürfen nur aus dem fairem Handel stammen. Um den Unterbietungswettbewerb zu beenden, gibt es einen Festpreis von 4,36 Euro pro Mahlzeit. Eine Kontrollstelle überprüft, dass die Vorgaben auch tatsächlich eingehalten werden und misst die Ausgabetemperatur.
Damit liegt Berlin zweifelsfrei vorne. Das bedeutet jedoch noch keine Qualität, die für die Ernährungswende nötig ist. Denn nicht nur die Herkunft der Zutaten sind dafür entscheidend, sondern auch Atmosphäre und Esskultur.
Mehr Esskultur statt Einheitsbrei!
Es gibt Studien, die eindrücklich belegen, dass gemeinsam zu Essen eine wichtige soziale Aktivität darstellt, die Wohlbefinden und Zusammenhalt von Gruppen enorm steigern kann. Wo vor Ort gekocht wird, besteht außerdem die Chance, dass Kinder etwas von der Essenszubereitung mitbekommen und gelegentlich auch daran beteiligt sind. Einige Kopenhagener Schulen nutzen Küchen und Mensen als wichtige soziale Lernorte. Ökonomisch rechnet sich eine eigene Küche auf jeden Fall ab 600 Portionen am Tag, in vielen Fällen reicht dafür sogar schon die halbe Menge. Das haben Wissenschaftler*innen in der sogenannten KuPS-Studie ausgerechnet und dabei auch Investitionskosten für Küchenausstattung und Personal einkalkuliert.
Doch wie in anderen Bereichen hat auch in den Küchen der in den vergangenen Jahrzehnten ein starker Konzentrationsprozess stattgefunden. Internationale Konzerne wie Sodexo geben täglich viele Millionen Essen aus und sind in Dutzenden von Ländern präsent. Auch Aramark, Dussmann und die Compass Group mit ihrer deutschen Tochterfirma Eurest sind Schwergewichte auf dem Caterer-Markt. Sie können Zutaten in riesigen Mengen günstig einkaufen und produzieren mit standardisierten Verfahren Massenware, die es dann gleichermaßen in Husum, Hamburg, Halle, Heidelberg oder Heidenheim zu essen gibt. Regionale Anbieter haben bei Unterbietungswettbewerben nur dann eine Chance, wenn sie beim Personal sparen und überwiegend Hilfskräfte beschäftigen.
Viele Großküchen zerhacken die Arbeit in kleine Teilschritte. Dass überdurchschnittlich viele Koch-Azubis dem Beruf den Rücken kehren, noch bevor sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, ist nachvollziehnbar. Die durch Fernseh-Shows genährte Vorstellung, dass es sich um einen kreativen Beruf handelt, stimmt in vielen Fällen nicht mit der Realität überein. Statt mit dem Messer Gemüse zu schneiden kommt vor allem die Schere zum Einsatz, um Tüten mit Tiefkühlkost oder vorgefertigten Convenience-Produkten aufzuschneiden.
Klares Fazit
Die Politik muss das Schulessen als einen entscheidenden Hebel für die Ernährungswende erkennen und nutzen. Bei den Zutaten gehen einige Städte und Regionen bereits mit gutem Beispiel voran. Doch das reicht nicht. Die sozialen Aspekt des Essens sind ebenso wichtig. Dazu gehört zu wissen, wo das Essen herkommt und möglichst auch diejenigen zu kennen, die es zubereitet haben. Zentral ist aber vor allem, etwas Schönes mit der Ernährungswende zu verbinden - und nicht in erster Linie den Verzicht auf Nackensteak und Currywurst. Im Prinzip ist das gar nicht schwierig: Gemeinsam etwas Leckeres genießen, Zeit zum Quatschen zu haben. Ist das nicht eine gute Aussicht in einer Welt, in der viele allein irgendetwas in sich hineinstopfen, nur damit es anschließend weitergehen kann mit dem übrigen Leben?
Annette Jensen ist freie Journalistin und engagiert sich zudem im Ernährungsrat Berlin. Vor Kurzem ist das Buch "Berlin isst anders. Ein Zukunfstmenü für Berlin und Brandenburg" unter ihrer Mitarbeit erschienen.
zurück zur Übersicht