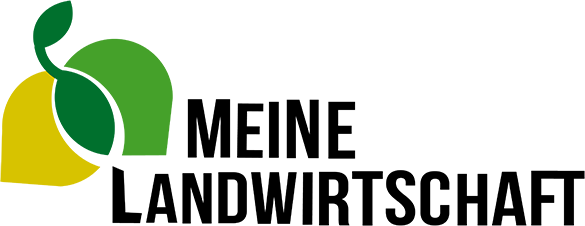Alte Debatte im neuen Gewand?
Wer Änderungen am Gentechnikrecht fordert, stellt auch Vorsorgeprinzip und Wahlfreiheit infrage.
Wer Änderungen am Gentechnikrecht fordert, stellt auch Vorsorgeprinzip und Wahlfreiheit infrage
Am 25. Juli 2018 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass mit neuen gentechnischen Verfahren wie CRISPR/Cas erzeugte Pflanzen und Tiere ohne Ausnahme unter das EU-Gentechnikrecht fallen. Mit dem Urteil geht ein alter Streit in die nächste Runde. Ausgetragen werden kann er nur nach den Regeln der Demokratie.
Es war ein überraschendes Urteil. Für alle. Was Gentechnik-Kritiker kaum noch zu hoffen wagten, hatte Befürworter hingegen kalt erwischt. Wie sehr sich führende Leitmedien deren Position allerdings zu eigen gemacht, überraschte nicht weniger: „Abschied von den Fakten“, titelte der Spiegel, „Die Angst vor der Gentechnik hat gewonnen“ die Süddeutsche, der Tagesspiegel „Die pauschale Verteufelung der Gentechnik hat gesiegt“ und der Fokus gar „Urteil von Europa-Richtern über Genschere ist eine linkspopulistische Zumutung“.
Der EuGH spricht Recht, er macht es nicht
Was war da los? Hat der EuGH tatsächlich Recht zugunsten von Kritikern interpretiert? Die deutliche Antwort lautet: Nein. Die fünfzehn Richter des Europäischen Gerichtshofs haben getan, wozu ihr Amt sie verpflichtet: Sie haben eine Bewertung über die in Europa geltende Rechtslage abgegeben. Die Richter urteilten, dass durch neue Gentechnikverfahren wie CRISPR/CAS veränderte Pflanzen und Tiere unter das geltende europäischen Gentechnikrecht fallen, egal, ob „nur“ eigenes verändert oder fremdes Erbgut eingefügt wurde. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Der EuGH spricht Recht, er macht es nicht. Das verbietet in einem Rechtsstaat das Prinzip der Gewaltenteilung. Gesetze zu ändern ist Sache von Parlamenten.
Wenn Rechtsstaat auf Rechtsempfinden trifft
Was also läuft im Demokratieverständnis schief, Urteile des höchsten Europäischen Gerichts als Eselei, Fehlurteil oder populistische Zumutung zu bezeichnen? Weil die Richter mit ihrem Urteil eine Rechtslücke geschlossen haben, die andere als Schlupfloch nutzen wollten? Und warum stellen gerade Journalisten die Gewaltenteilung infrage, die sie im Fall von Sami A. vor den Ansprüchen eines vermeintlichen Rechtsempfindens verteidigt haben?
Und wessen Rechtsempfinden stellt das Urteil eigentlich in Frage? Das der breiten Bevölkerung ganz sicher nicht. Das hält die Anfang Juli 2018 vom Bundesamt für Naturschutz veröffentlichte Naturbewusstseinsstudie deutlich fest: Nahezu unverändert sprechen sich seit vielen Jahren für ein Verbot von Gentechnik in der Landwirtschaft aus. Laut der Studie sind sogar 93 Prozent der Befragten der Meinung, dass möglichen Auswirkungen auf die Natur immer untersucht werden sollten, wenn Pflanzen gezielt gentechnisch verändert werden und wünschen sich sogar eine umfassendere Kennzeichnung als bisher.
93 Prozent wollen umfassendere Kennzeichnung von Gentechnik
Das Urteil verbietet keine Gentechnik. Nur, sie unterzujubeln
Wenn das Urteil also eins gezeigt hat, dann, wie gut das bestehende Recht den Wünschen und Erwartungen der Bevölkerung entspricht. Denn die Richterinnen begründeten ihr Urteil ausdrücklich damit, dass „der Schutz der menschlichen Gesundheit eine gebührende Kontrolle der Risiken infolge einer solchen Freisetzung erfordert“ und der Grundsatz der Vorsorge ausdrücklicher Zweck der Richtlinie sei. Neue gentechnische Verfahren aus der Richtlinie auszunehmen, würde den Willen des Gesetzgebers nicht nur bezüglich der Richtlinie unterlaufen, sondern das übergeordnete europäische Vorsorgeprinzip.

Dass andere europäische Gesetze diese Vorsorgepflicht nicht ausreichend gewährleisten können, hatte der Umweltrechtler Tade Matthias Spanger in einem Gutachten für das Bundesamt für Naturschutz (BfN) bereits belegt.
Diese Regelungslücke haben die Straßburger Richter geschlossen. Ein Verbot neuer Gen-Techniken ist das nicht. Im Gegenteil schafft das Urteil erst Rechtssicherheit über die Regeln, nach denen diese Produkte erzeugt, angebaut und auf den Markt gebracht werden können. Dazu gehört, dass diese Produkte gekennzeichnet werden müssen und Verbrauchern und Landwirten nicht einfach untergejubelt werden können. Wer darin ein faktisches Verbot sieht bzw. die fehlende Akzeptanz fürchtet, sollte sein Geschäftsmodell hinterfragen und nicht rechtsstaatliche Entscheidungen.
Das neue Narrativ: Wie die Natur, nur schneller, besser, billiger und ohne Risiko
Zumindest eine Auseinandersetzung scheint mit dem Urteil vorerst beendet: Die neuen Genom-Editing-Verfahren sind Gentechnik und heißen auch so. Jahrelang wurde das versucht mit Begrifflichkeiten wie „Neue Züchtungsmethoden“ oder „Molekularbiologische Techniken“ zu verhindern, um Akzeptanzproblemen und einer Regulierung als Gentechnik vorzubeugen. Begründet wird das damit, dass Gentechnik nur im Prozess zur Anwendung käme, im erzeugten Organismus aber nicht mehr vorhanden und nachweisbar sei. Damit gäbe es keinen Unterschied zu herkömmlichen Züchtungsprodukten oder der Lese, die die Natur selber hält - und damit keine Veranlassung zu einer gesonderten Regulierung.
Eine Behauptung, die sich nach heutigem Stand der Wissenschaft nicht aufrechterhalten lässt. Der Einsatz von Methoden wie CRISPR/ Cas hinterlässt nachweisbare Spuren. Und nicht nur das. Die Genom-Editing-Verfahren verändern das Erbgut so umfassend und vollständig, dass die erzeugten Organismen ihre natürlichen Kontroll- und Reparaturmechanismen verlieren. Hinzu kommen ungewollte Veränderungen, die erst nach Jahren auftreten können. Auf dieses Risiko haben die Richter in ihrem Urteil ausdrücklich Bezug genommen und auf die Notwendigkeit einer eingehenden Überwachung verwiesen.
Genau das lehnen die Hersteller allerdings ab. Die Technik sei sicher, darüber bestünde wissenschaftlicher Konsens. Wer das infrage stelle, solle das Gegenteil beweisen. Warum? Seit wann ist es Sache der Gesellschaft, Beweise gegen Behauptung zu liefern? Und wie sollen Risiken für unsere Umwelt und menschliche Gesundheit überhaupt erkannt werden, wenn sie nicht gründlich geprüft und überwacht werden? Und warum sollte ausgerechnet für die Grüne Gentechnik nicht gelten, was für die Weiße und Rote Gentechnik so selbstverständlich wie unstrittig ist? Werden GVOs einmal in die Natur entlassen, ist das eine unumkehrbare Entwicklung, die ungleich schneller und weitreichender stattfindet als unter den steuerbaren Bedingungen geschlossener Systeme und der Humantherapie.
Hält die Technik, was sie an Risikofreiheit verspricht, brauchen die Hersteller die Auflagen einer Überwachung nicht zu fürchten. Ebenso wenig wie die höheren Zulassungskosten, denn liefern die neuen Sorten und Rassen die versprochenen Eigenschaften, sollten sich diese Kosten problemlos wiedereinspielen lassen.
Ablehnung aus Luxusgründen?
Fraglich bleibt allerdings, warum man diesen Versprechen Glauben schenken sollte. Dem Klimawandel trotzende, den Pestizideinsatz reduzierende und den Welthunger stillende Sorten hatte bereits die alte Gentechnik vor mehr als zwanzig Jahren versprochen. Sie sind bis heute nicht eingelöst. Worauf soll das Vertrauen gründen, dass die neuen Gen-Technik genau das jetzt liefern werden? Auf das Geständnis, dass die klassische Gentechnik versagt hat?
Unbeirrt davon erklärte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner Anfang September, dass die neuen Technologien landwirtschaftliche Probleme lösen könne, weshalb sie gegen Einschränkungen neuer Gentechniken vorgehen werde. „Wir müssen achtgeben, dass wir nicht aus Luxuspositionen des Überflusses heraus in Europa eine neue Technologie vor die Tür setzen”. Sind der Schutz der biologischen Vielfalt sowie das Recht von Verbrauchern und Landwirten, Gentechnik ablehnen zu können, überflüssiger Luxus? Und wer setzt hier eine Technik vor die Tür?
Die nächste Runde eines alten Streites ist also längst eröffnet. Erstaunlich daran ist, in welcher Geschwindigkeit, von welcher Ebene und mit welchen Argumenten Rechtsurteile infrage und die Forderung nach Gesetzesänderungen erhoben werden.
Richtig ist: Was Recht ist, muss nicht immer Recht bleiben. Demokratie lebt davon, dass Recht immer wieder neu verhandelt werden muss. Das geht aber nur mit Respekt vor rechtsstaatlichen Entscheidungen sowie unter Berücksichtigung aller gesellschaftlicher Interessen.
Im Koalitionsvertrag hat sich die Bundesregierung übrigens zu Regeln verpflichtet, „die das Vorsorgeprinzip und die Wahlfreiheit gewährleisten“. Ein Versprechen, an das sich auch die zuständige Ministerin ohne Wenn und Aber gebunden fühlen sollte.
Dieser Artikel von Ilka Dege erschien zuerst in Umwelt Aktuell 10-2018. Die Autorin ist Koordinatorin Agrar, Natur- und Tierschutzpolitik beim Deutschen Naturschutzring.
zurück zur Übersicht